Das Ergebnis der Neuwahl des niederländischen Parlaments: Geert Wilders erreicht das bislang höchste Ergebnis
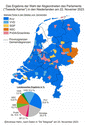 Den Haag, 23 November 2023: Bei der vorgezogenen (Neu-)Wahl des niederländischen Parlaments („Tweede Kammer“) kann die rechtspopulistische Partei des Politikers Geert Wilders (Bild: Mitte), die PvV („Partij voor de Vrijheid“) mit ihrem bislang höchsten Ergebnis (23,7 %, + 12,8 %-Pkte.) den ersten Platz im Parteienranking erzielen. Damit reiht sich die Niederlande ein in die Staaten, bei denen eine rechtspopulistische recht hohe Ergebnisse erreicht.
Den Haag, 23 November 2023: Bei der vorgezogenen (Neu-)Wahl des niederländischen Parlaments („Tweede Kammer“) kann die rechtspopulistische Partei des Politikers Geert Wilders (Bild: Mitte), die PvV („Partij voor de Vrijheid“) mit ihrem bislang höchsten Ergebnis (23,7 %, + 12,8 %-Pkte.) den ersten Platz im Parteienranking erzielen. Damit reiht sich die Niederlande ein in die Staaten, bei denen eine rechtspopulistische recht hohe Ergebnisse erreicht.
Schaut man sich die Situation auf der Karte an, so erzielt die PvV in weitaus den meisten Gemeinden eine relative Mehrheit, nur wenige Gemeinden haben eine Mehrheit einer anderen Partei. Die calvinistische SGP („Staatkundig Gereformeerde Partij“) erzielt 2,1 % und auch in einigen Gemeinden eine relative Mehrheit.
Große Gewinnerin ist ebenfalls die NSC („Nieuw Sociaal Contract“), die auf Anhieb auf 12,8 % kommt, sowie auch  Mehrheiten in einigen Gemeinden hat. Diese Partei wurde erst im August 2023 gegründet und wird der christlichen Soziallehre entsprechend nahe eingeordnet.
Mehrheiten in einigen Gemeinden hat. Diese Partei wurde erst im August 2023 gegründet und wird der christlichen Soziallehre entsprechend nahe eingeordnet.
Das Parteienbündnis aus „Groenlinks“ und PvdA („Partij van de Arbeid“) kann 15,6 % auf sich vereinigen. Allerdings, wenn man das aktuellen Ergebnis mit dem der Wahl von 2021 vergleicht, so legen beide Parteien nur 4,6 Prozentpunkte zu.
Die Demokraten 66 (D66) sind auch zu den Verlierern zu rechnen, denn diese Partei büßt im Vergleich mit dem Ergebnis von 2021 8,8 %-Punkte ein auf jetzt 6,2 %.
Die früher in den Niederlanden führende Partei CDA („Christen-Democratisch Appèl“) erreichte dieses Mal nur noch 3,3 % (- 6,2 Prozentpunkte).
Kommentar: Kurz nach den Präsidentschaftswahlen in Argentinien kann also, wie oben schon erwähnt, wieder 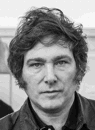 ein rechtspopulistischer Politiker punkten.
ein rechtspopulistischer Politiker punkten.
In Argentinien hatte der rechtspopulistische Politiker Javier Gerardo Milei (Foto: links) mit immerhin fast 56 % die Präsidentschaftswahl gewonnen. Er selbst nennt sich „ultralibertär“. Argentinische Wahlanalytiker sehen den Sieg Mileis eher als Protesthaltung gegen die politischen Eliten. Mileis Gegenkandidat Massa ist Finanzminister des Landes und wird für die im Land hohe Inflation verantwortlich gemacht.
Ebenso kann man den Wahlerfolg von Wilders ansehen. Auch in den Niederlanden hatte sich ein Frust über die politische Elite angestaut, die sich auch auf die Einwanderung bezog. Wilders konnte somit punkten, allerdings kaum Lösungsansätze anbieten.
Zudem sind sehr viele Stimmen an die NSC gegangen und auch an andere rechte Parteien wie z. B. die FVD („Forum voor Democratie“) und JA 21.
Faktisch haben eher im linken politischen Spektrum angesiedelte Parteien einen Anteil von gerade ein Viertel der gültigen Stimmen, 2021 waren es noch über 31 %.
Durchschnitt bei der „Sonntagsfrage“ im Oktober 2023: Starke Rückgänge bei fast allen Parteien
Berlin, 1.November 2023: Allein die CDU und CSU sind die Gewinnerinnen in den demoskopischen Durchschnittswerten des letzten Monats. Genauer gesagt: Die Unionsparteien und bei den unter der Bezeichnung „Sonstige“ zusammengefassten Parteien sind Gewinne im Vergleich mit den Durchschnittsdaten des Septembers zu erkennen. Besonders die „Sonstigen“ legen im vergangenen Monat zu um 4,9 %-Punkte im Vergleich mit dem Ergebnis der letzten Bundestagswahl. Zu vermuten ist dabei ein Anstieg bei den „Freien Wählern“.
Die CDU/CSU kommt demnach im Oktober auf 27,7 % (+ 3,6 %-Pkte.) Die Parteien, die die derzeit im Bund regierende „Ampelkoalition“ (SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen) bilden, verlieren im Vergleich mit dem Ergebnis der Bundestagswahl 18,1 %-Pkte. und erzielen zusammen nur noch 33,9 %. Die Union wie auch die AfD kommen im Oktober auf 48,2 %, was einen (theoretischen) Zugewinn von 13,8 %-Pkten ausmachen würde.
Ob und inwieweit sich diese Trends fortsetzen, lässt sich beim besten Willen nicht vorhersagen. Zumal sich erst mit den Freien Wählern ein neuer Wettbewerber dazu gesellt, neuerdings wird auch darüber diskutiert, ob und inwieweit sich eine Partei der ehemaligen Politikerin der LINKEN, Sahra Wagenknecht, ebenfalls etablieren könnte. Dieser wird in einigen Umfragen ein Anteil von bis zu 12 % zugetraut.
Allerdings sind derlei hohe Anteile zu verfrüht: in der Wahlgeschichte Deutschlands sind schon oft Parteien demoskopisch mit hohen Werten versehen worden, nur um dann mit niedrigen Werten bei tatsächlichen Wahlen zu scheitern, so z. B. vor einigen Jahren die „Piraten“ oder in den neunziger Jahren die sog. „STATT-Parteien“.
In Mandaten stellt sich dieses Durchschnittsergebnis wie folgt dar: Die SPD würde 117 Mandate erhalten, die CDU/CSU 212, die Grünen kämen auf 103 Sitze, die FDP auf 41 sowie die AfD auf 157 Mandate, die LINKE ginge mit 4,3 % leer aus.
Zur Erklärung: Es handelt sich bei dieser Rangliste nicht um eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, sondern dem Durchschnittswert, der sich aus der Berechnung der veröffentlichten Umfragedaten eines gesamten Monats der Institute Kantar, Infratest-Dimap, INSA-Consulere, der Forschungsgruppe Wahlen e. V., dem FORSA-Institut und dem Institut für Demoskopie (Allensbach) sowie YouGOV ergibt.
Nationalratswahl in der Schweiz: SVP gewinnt wieder hinzu
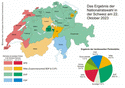 Bern, 24. Oktober 2023: Die aktuelle Nationalratswahl in der Schweiz hat die “Schweizer Volkspartei” (SVP), wie allgemein erwartet, einen Stimmenzuwachs erzielt. Die SVP, die 1971 gegründet wurde und als rechtspopulistisch eingestuft wird, konnte eher leicht hinzu gewinnen mit rund 2,3 %-Punkten auf aktuelle 27,9 Prozent. Verlierer der Wahl sind die beiden schweizer Grünen-Parteien, die zusammen 3,8 %-Punkte einbüßten (Grüne Schweiz: - 3,6 Punkte, Grün-Liberale: - 0,2 %-Punkte) auf zusammen 17,4 %.
Bern, 24. Oktober 2023: Die aktuelle Nationalratswahl in der Schweiz hat die “Schweizer Volkspartei” (SVP), wie allgemein erwartet, einen Stimmenzuwachs erzielt. Die SVP, die 1971 gegründet wurde und als rechtspopulistisch eingestuft wird, konnte eher leicht hinzu gewinnen mit rund 2,3 %-Punkten auf aktuelle 27,9 Prozent. Verlierer der Wahl sind die beiden schweizer Grünen-Parteien, die zusammen 3,8 %-Punkte einbüßten (Grüne Schweiz: - 3,6 Punkte, Grün-Liberale: - 0,2 %-Punkte) auf zusammen 17,4 %.
Neu trat die aus der BDP und der CVP hervorgegangene Partei „Die Mitte“ an und erreichte 14,1 %. Im Vergleich mit den vorgegangenen Wahlergebnissen beider Parteien legte diese Neugründung um 1,2 %-Punkte zu. Gewinner ist auch die Schweizer „Sozialdemokratische Partei“ (SP) mit 1,5 %-Punkten auf aktuelle 18,3 %. Die „FDP. Die Liberalen“ erreicht 14,3 % (- 0,9 %-Punkte).
Die SVP ist erstmal 1999 stärkste Partei in der Schweiz geworden. 2015 kam sie nahe an die 30 % heran (29,4 %), fiel dann zurück auf 25,6 % und erreicht jetzt ihr bislang dritthöchstes Ergebnis.
Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Hessen und Bayern am 8. Oktober 2023 - Bericht und Kommentar
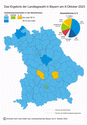 Wiesbaden, München, 9. Oktober 2023: Die beiden Landtagswahlen am gestrigen Sonntag haben zum Ergebnis eine gestärkte AfD und in Bayern auch eine gestärkte Partei „Freie Wähler“. In Hessen ist die AfD nun bei 18,4 % angelangt, in Bayern beträgt ihr Anteil 14,6 %. Die Freien Wähler liegen in Bayern nun bei 15,4 %, nach 11,2 % im Jahr 2018. Die AfD gewann in Bayern mit 4,4 %-Punkte am höchsten hinzu.
Wiesbaden, München, 9. Oktober 2023: Die beiden Landtagswahlen am gestrigen Sonntag haben zum Ergebnis eine gestärkte AfD und in Bayern auch eine gestärkte Partei „Freie Wähler“. In Hessen ist die AfD nun bei 18,4 % angelangt, in Bayern beträgt ihr Anteil 14,6 %. Die Freien Wähler liegen in Bayern nun bei 15,4 %, nach 11,2 % im Jahr 2018. Die AfD gewann in Bayern mit 4,4 %-Punkte am höchsten hinzu.
Dagegen ist die SPD in beiden Bundesländern stark abgeschlagen, in Bayern erzielt sie nunmehr 8,4 % (-1,3 %-Punkte) in Hessen liegt die SPD auf dem dritten Platz mit 15,1 % (-4,7 %-Punkte). Bei der Landtagswahl vor 40 Jahren, am 25. September 1983, erzielte die hessische SPD 46,2 % bei einem Zugewinn von 3,4 %-Punkten. Von den 55 Direktmandaten holte die SPD damals 42, dieses Mal keines.
In Bayern, wo am 10. Oktober 1982 gewählt wurde, erzielte die CSU bei einer Wahlbeteiligung von 78 % insgesamt 58,3 %, die SPD kam damals auf 31,9 %.
Die Partei Bündnis 90/Die Grünen hat in beiden Bundesländern an Stimmen verloren, der Verlust in Hessen ist mit 5,0 %-Punkte deutlich höher als der in Bayern (-3,2 %-Punkte). Während in Hessen die CDU massiv hinzugewann (+ 7,6 %-Punkte), stagniert die CSU in Bayern bei 37 %. 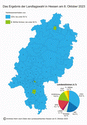 In Hessen ergeben sich aus den 52 Direktmandaten der CDU für diese insgesamt 9 Überhangmandate und 14 Ausgleichsmandate für die anderen Parteien, also insgesamt 133 Mandate statt der 110 gesetzlich vorgesehenen Sitze.
In Hessen ergeben sich aus den 52 Direktmandaten der CDU für diese insgesamt 9 Überhangmandate und 14 Ausgleichsmandate für die anderen Parteien, also insgesamt 133 Mandate statt der 110 gesetzlich vorgesehenen Sitze.
Schaut man sich an, wie die jeweiligen Spitzenkandidaten bzw. die Spitzenkandidatinnen bewertet werden, so fällt auf, dass in Hessen – nach Daten der Forschungsgruppe Wahlen - der von der CDU gestellte Ministerpräsident Boris Rhein auf 61 % kommt bei der Frage „wen die Menschen lieber als Ministerpräsidenten hätten“, während die SPD-Spitzenkandidatin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, lediglich 21 % überzeugen kann. Bei der Bewertung der Person auf der Skala zwischen – 5 und + 5 erzielt Rhein einen positiven Wert von +1.5, während Faeser auf einen Negativwert von -1.3 kommt.
Die AfD erreichte, so die Forschungsgruppe Wahlen, bei Männern 22 %, bei den Frauen 14 %. So zeigt sich auch hier die typische Verteilung bei rechtspopulistischen Parteien, in Hessen sind 61 % der AfD-Wählerschaft Männer.
SPD wie auch die CDU haben in der Altersgruppe der über 60-jährigen ihre höchsten Ergebnisse. So ermittelte die Forschungsgruppe Wahlen einen Anteil von 20 % für die SPD und 43 % für die CDU in dieser Altersgruppe. Die CDU erreicht bei den Arbeitern 33 %, die SPD erzielt hier nur noch 15. Selbst die AfD schneidet in diesem Segment mit 29 % besser ab als die SPD.
In Bayern gibt es ebenfalls Überhang- und Ausgleichsmandate. Mit 85 Direktsitzen (Stimmkreisergebnisse) erzielt die CSU 11 Mandate mehr, als ihr nach der gesetzlichen Verteilung zustünden. Damit erhalten die anderen Parteien 12 Ausgleichssitze. Insgesamt hat der neue bayerische Landtag 203 statt der eigentlichen 180 Mandate.
Im Vorfeld zu dieser Landtagswahl hatte es um den Spitzenkandidaten der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, heftige Diskussionen gegeben. Dieser wurde als Schüler dabei ertappt, ein rechtsextremistisches und antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Als Schüler eines Gymnasiums soll er dann vor einem Disziplinarausschuss der betreffenden Schule nicht abgestritten haben, Verfasser des Flugblattes gewesen zu sein. Angeblich ist nun, so Aiwanger, sein älterer Bruder für das Pamphlet verantwortlich gewesen.
Offenbar schien diese Affäre, so muss man leider festhalten, den Freien Wählern nicht geschadet zu haben. Die Forschungsgruppe Wahlen hat auch nach der „Flugblattaffäre“ gefragt und rausbekommen, dass 44 % der bayerischen Befragten die Ansicht vertreten, dass diese Affäre den Freien Wählern eher genutzt habe als geschadet. Und das Wahlergebnis scheint diese Ansicht zu untermauern, denn die Freien Wähler legten um 4,2 %-Punkte zu.
Insgesamt kann die Hessen-CDU also jubeln, die CSU bleibt, wie seit 1954, stärkste Partei in Bayern. Die SPD sollte sich hingegen Sorgen machen, denn sie ist vor allem in Bayern nicht mehr weit von der Fünf-Prozent-Hürde entfernt.
Durchschnitt bei der „Sonntagsfrage“ im September: AfD-Wachstum geht weiter
Berlin, 1. Oktober 2023: Bei der letzten Bundestagswahl (Herbst 2021) erzielte die AfD - bei Verlusten gegenüber der von 2017 in Höhe von 2,3 -Punkten – 10,3 %. Im Durchschnitt der 24 Sonntagsfragen des gesamten Monats September liegt sie nun bei 21,4 % und hätte – zumindest demoskopisch - ihren Anteil mehr als verdoppelt. In nur einer der 24 Erhebungen der acht führenden Institute befindet sich die AfD unterhalb von 20 %, bei YouGOV erreichte sie erneut – wie im August - 23 %, in der GMS-Umfrage bekam sie ebenfalls 23 %.
Bei der derzeit regierenden „Ampel-Koalition“, bestehend aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen sowie der FDP sehen die demoskopischen Durchschnittswerte einen Gesamtverlust von 14,2 %-Punkten, wobei die SPD mit einem Minus gegenüber dem letzten Bundestagswahlergebnis von 8,7 %-Punkten die höchsten Einbußen erdulden muss. Die FDP büßt 5,0 %%-Punkte (auf jetzt 6,5 %) ein, das macht ca. 43 % ihrer Wählerschaft von 2021 aus, während die SPD ca. 34 % ihrer Wählerschaft vom Herbst 2021 einbüßen würde. Aber Voraussetzung ist, dass sich diese durchschnittlichen Umfragedaten auch in einem realen Wahlergebnis zeigen.
Die CDU und CSU sind zusammen mit durchschnittlichen 27 % (+ 2,9 %-Punkte) zwar stärkste Partei(en), aber mit diesem Wert bleiben beide hinter ihren Erwartungen. Die LINKE kommt in vierzehn der 24 Sonntagsfragen auf 5 %. Dennoch liegt sie mit 4,6 Prozent immer noch unterhalb der 5-%-Hürde.
Ob und wie sich diese Werte insgesamt fortsetzen oder ändern, wird sich nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen, beide am 8. Oktober, zeigen. Interessant ist es auch, dass sowohl bei der Forschungsgruppe Wahlen, Infratest-Dimap, INSA und YouGOV erstmals die Freien Wähler als Partei aufgezeigt werden. Dabei erreichen diese zumindest bei den drei erstgenannten Instituten sogar mehr als 3,0 %.
Zusammen kommt die regierende Ampel-Koalition auf 37,8 % (-14,2 %-Pkte.), die Oppositionsparteien erzielen demoskopische 53,0 % (+14,0 %-Pkte.). Ohne den Anteil der LINKEN sind es immer noch 48,4 %. In Mandaten würde sich dieses Durchschnittsergebnis wie folgt darstellen: Die SPD würde 124 Mandate erhalten, die CDU/CSU 197, die Grünen kämen auf 105 Sitze, die FDP auf 48 sowie die AfD auf 156 Mandate, die LINKE ginge mit 4,6 % leer aus.
Zur Erklärung: Es handelt sich bei dieser Rangliste nicht um eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, sondern dem Durchschnittswert, der sich aus der Berechnung der veröffentlichten Umfragedaten eines gesamten Monats der Institute Kantar, Infratest-Dimap, INSA-Consulere, der Forschungsgruppe Wahlen e. V., dem FORSA-Institut, GMS und dem Institut für Demoskopie (Allensbach) sowie YouGOV ergibt.
Sonntagsfragen-Durchschnitt im August: AfD jetzt doppelt so stark wie bei der Bundestagswahl
Berlin, 1. September 2023: Bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 erzielte die AfD - bei Verlusten gegenüber der von 2017 in Höhe von 2,3 -Punkten – 10,3 %. Im Durchschnitt der 24 Sonntagsfragen des gesamten Monats August liegt sie nun bei 20,6 % und hätte – zumindest demoskopisch - ihren Anteil faktisch verdoppelt. In nur vier der 24 Erhebungen befindet sich die AfD unterhalb von 20 %, bei YouGOV erreichte sie Anfang August 23 %, in der gestrigen „Deutschlandtrend“-Umfrage bekam sie 22 %.
Bei der derzeit regierenden „Ampel-Koalition“, bestehend aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen sowie der FDP sehen die demoskopischen Durchschnittswerte einen Gesamtverlust von 12,7 %-Punkten, wobei die SPD mit einem Minus gegenüber dem letzten Bundestagswahlergebnis von 7,7 %-Punkten die höchsten Einbußen erdulden muss. Die FDP büßt 4,6 %%-Punkte (auf jetzt 6,9 %) ein, das macht ca. 40 % ihrer Wählerschaft von 2021 aus, während die SPD ca. 30 % ihrer Wählerschaft vom Herbst 2021 einbüßen würde. Aber Voraussetzung ist, dass sich die Umfragedaten auch in einem realen Wahlergebnis zeigen.
Die CDU und CSU sind zusammen mit durchschnittlichen 26,6 % (+ 2,5 %-Punkte) zwar stärkste Partei(en), aber mit diesem Wert bleiben sie hinter ihren Erwartungen.
Die LINKE kommt in dreizehn der 24 Sonntagsfragen auf 5 %, in zweien sogar auf 6 %. Dennoch liegt sie mit 4,7 % unterhalb der 5-%-Hürde.
Zusammen kommt die regierende Koalition auf 39,3 %, die Oppositionsparteien erzielen demoskopische 51,9 %. Ohne den Anteil der LINKEN sind es immer noch 47,2 %. In Mandaten würde sich dieses Durchschnittsergebnis wie folgt darstellen: Die SPD würde 131 Mandate erringen, die CDU/CSU 194, die Grünen kämen auf 105 Sitze, die FDP auf 50 sowie die AfD auf 150 Mandate, die LINKE ginge mit 4,7 % leer aus.
Zur Erklärung: Es handelt sich bei dieser Rangliste nicht um eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, sondern dem Durchschnittswert, der sich aus der Berechnung der veröffentlichten Umfragedaten eines gesamten Monats der Institute Kantar, Infratest-Dimap, INSA-Consulere, der Forschungsgruppe Wahlen e. V., dem FORSA-Institut, GMS und dem Institut für Demoskopie (Allensbach) sowie YouGOV ergibt.
Umfragen zur Bundestagswahlabsicht lassen mehr Fragen offen, als dass sie sie beantworten
Berlin, 20. August 2023: Sieht man sich nur die in dieser Woche veröffentlichten Umfragedaten der acht (oder neun) führenden Institute an, wobei das Allensbacher Institut für Demoskopie die derzeit „ältesten“ Daten bereithält (Stand: 27. Juli 2023), so sind die Institute sich zwar irgendwie einig, dass die AfD massiv im Vergleich mit dem Bundestagswahlergebnis 2021 aufgeholt hat, aber in der derzeitigen Höhe des AfD-Anteils sind sie sich uneinig: Beim IfD erreicht die AfD 18 %, bei YouGOV sind es 23 % (Stand: 4. August 2023), FORSA, GMS, Infratest-Dimap sowie INSA sehen die AfD bei jeweils 21 %. Im Durchschnitt aller Institute liegen die Rechtspopulisten bei 20,7 %.
Die SPD erreicht im Schnitt 17,7 %, die CDU/CSU erzielt 26,7 %. Gerade in Bezug auf die Unionsparteien kann man gespannt sein, ob sich höhere Umfragedaten für diese ergeben, ihr Durchschnitt liegt nur 2,6 %-Punkte über ihrem letztmaligen Bundestagswahlergebnis, während die AfD eben einen doppelt so hohen – demoskopischen - Anteil hat, wie sie bei der letzten Bundestagswahl (10,3 % der Zeitstimmen) erreichte.
Auch die Anzahl der Befragten, die bei FORSA mit rund 2500 Personen am höchsten ist, zeigt sich zumindest bei den AfD-Anteilen nicht sonderlich ausschlaggebend in der Höhe, aber auch bei den Anteilen der anderen Parteien ist kein wirklich gravierender Unterschied zu erkennen. Die Anteile sowohl von der SPD wie auch von CDU und CSU liegen mit +/- 2 %-Punkte im Bereich der statistischen Schwankungsbreiten.
Zur Verwirrung des interessierten Publikums tragen aber Meldungen bei, dass beispielsweise am 18. August die Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen beinhaltete, die SPD habe im Vergleich mit der Umfrage vom 14. Juli desselben Instituts um 2 Prozentpunkte zugelegt, die Union sowie Bündnis 90/Die Grünen um jeweils einen Punkt abgenommen hätten. Bei der zwei Tage später in der „BILD am Sonntag” erscheinenden Umfrage des INSA-Instituts verlor 2 Punkte die SPD im Vergleich mit der Umfrage, die in demselben Medium nur eine Woche zuvor veröffentlicht wurde, die CDU/CSU legte - wie die Grünen und die FDP um jeweils einen Punkt hinzu. Übrigens: Passend zu dem etwas reißerischen Artikel zur (angeblichen?) Unbeliebtheit der regierenden „Ampel-Koalition” aus SPD, Grünen und FDP. Diese Koalition tut aber auch nicht viel, um ihre Werte zu verbessern. Und die Medien glauben halt nur dem Institut, welches sie alimentieren.
Letzten Endes sagen die Umfrageergebnisse demnach nicht allzu viel über die Chancen der Parteien bei der kommenden Bundestagswahl aus, die Daten zeigen halt nur die aktuellen Werte. Dass es also zu einem überwältigen Wahlerfolg der AfD kommen wird, ist also längst nicht ausgemacht. Aber auch nicht ausgeschlossen. Mit anderen Worten: Die nächste Bundestagswahl wird so oder auch ganz anders ausgehen, das hängt dann von den Werten ab.
Sonntagsfragen-Durchschnitt im Juli 2023: AfD jetzt über 20% und somit 2 Punkte vor der SPD
Berlin, 1. August 2023: In den 25 „Sonntagsfragen“ („Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?“) des Juli 2023 erreicht die AfD, die vor etwa einem Jahr bei rund 11 % im Durchschnitt gelegen hatte, nun 20,2 %. Damit hätte diese Partei ihren letztmaligen Stimmenanteil bei der Bundestagswahl im Jahr 2021 fast verdoppelt. Eben vor diesem einen Jahr – etwa Herbst 2022 - setzte die rechtspopulistische Partei zu ihrem stetigen Zuwachs an, der insgesamt zu rund 2 %-Punkten vor der SPD geführt hat. Die höchsten Anteile für die AfD wurden im Juli mit 22 % von INSA-Consulere ermittelt, den niedrigsten Anteil erzielte die AfD beim Allensbacher Institut für Demoskopie mit 18 %.
Die Sozialdemokraten liegen im „Parteienranking“ im Juli bei 18,2 % und somit 7,5 %-Pkte. unterhalb ihres letzten Wahlergebnisses, während Bündnis 90/Die Grünen sich im Juli bei 14,5 % (- 0,3 %-Pkte.) einpendelt.
Die FDP ist im Juli wieder etwas schwächer mit durchschnittlich 6,8 % (- 4,7 %-Pkte.), die LINKE kommt im Juli 4,8 % und würde somit im Vergleich zum Bundestagswahlergebnis 0,1 %-Pkt. einbüßen.
Die CDU/CSU wiederum kann sich nicht wirklich freuen über ihre aktuellen 26,8 %, würde aber ca. 2,7 % zum letztmaligem Bundestagswahlergebnis hinzugewinnen. Sie hatte im Mai allerdings noch bei durchschnittlichen 28.9 % gelegen.
In Sitze für den Bundestag umgerechnet ergäbe sich die folgende Verteilung: Die SPD käme auf 132 Mandate, die CDU/CSU auf 195, Bündnis 90/Die Grünen könnten bei den durchschnittlichen Umfragedaten mit 106 Mandaten rechnen, die FDP mit 50 und die AfD mit 147 Sitzen. Die LINKE erreicht kein Mandat.
Zur Erklärung: Es handelt sich bei dieser Rangliste nicht um eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, sondern dem Durchschnittswert, der sich aus der Berechnung der veröffentlichten Umfragedaten eines gesamten Monats der Institute Kantar, Infratest-Dimap, INSA-Consulere, der Forschungsgruppe Wahlen e. V., dem FORSA-Institut, GMS und dem Institut für Demoskopie (Allensbach) sowie YouGOV ergibt.
Wahl in Spanien bringt offenbar (noch) keinen Wechsel - Bericht und Kommentar
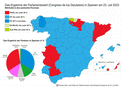 Madrid, 23. Juli 2023: Die vorgezogene Parlamentswahl in Spanien bringt offenbar keinen Wechsel in der Regierung. Auch wenn die konservative Partido Popular (Volkspartei) immerhin im Vergleich mit dem Ergebnis der Wahl vom November 2019 bei einer aktuellen Wahlbeteiligung von 70,4 % (+ 4,2 %-Pkte.) einen massiven Stimmenzugewinn von 12,2 %-Pkte. auf jetzt 33,1 % einfährt, kann sie zusammen mit der rechtspopulistischen Partei VOX (Stimme) dennoch keine Mehrheit im Parlament erringen. Zusammen hätten beide 169 Mandate, für eine Mehrheit sind aber mindestens 176 Sitze notwendig bei den 350 Gesamtmandaten.
Madrid, 23. Juli 2023: Die vorgezogene Parlamentswahl in Spanien bringt offenbar keinen Wechsel in der Regierung. Auch wenn die konservative Partido Popular (Volkspartei) immerhin im Vergleich mit dem Ergebnis der Wahl vom November 2019 bei einer aktuellen Wahlbeteiligung von 70,4 % (+ 4,2 %-Pkte.) einen massiven Stimmenzugewinn von 12,2 %-Pkte. auf jetzt 33,1 % einfährt, kann sie zusammen mit der rechtspopulistischen Partei VOX (Stimme) dennoch keine Mehrheit im Parlament erringen. Zusammen hätten beide 169 Mandate, für eine Mehrheit sind aber mindestens 176 Sitze notwendig bei den 350 Gesamtmandaten.
Die sozialdemokratische PSOE (Partido Socialista Obrero Españo) kann mit einem Zugewinn von 3,7 %-Pkte. auf aktuelle 31,7 Prozent zumindest nicht als Verlierer angesehen werden. Nur: Auch zusammen mit ihrer anvisierten Koalitionspartnerin SUMAR, die 12,3 % erzielte, kommen die Sozialisten und SUMAR auf insgesamt 153 Mandate.
Von den Regionalparteien erzielen lediglich die linke baskische Partei EH BILDU sowie die bürgerlich-baskische EJA-PNV jeweils eine Mehrheit in den baskischen Provinzen Vizcaya bzw. Guipuzcoa zu erringen.
Offenbar funktionierte der Wahlkampf der PSOE, die Stimmung zu polarisieren mit der Warnung, dass die PP mit VOX koalieren wolle (was die PP nicht deutlich ausschloss). Denn sowohl VOX, aber auch die Partei SUMAR verloren 2,7 bzw. 3 %-Pkte. im Vergleich mit dem Ergebnis vom November 2019. Welche Regierung mit welcher Mehrheit aber gebildet werden kann, das ist nicht klar und deswegen wird es wohl auf eine Neuwahl hinauslaufen.
AfD pendelt sich demoskopisch nun vor der SPD ein
Berlin, 9. Juli 2023: Am Monatsende des Juni 2023 lag die AfD genau Kopf-an-Kopf mit der SPD im Durchschnitt der Umfragen, bzw. der „Sonntagsfrage“ („Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?“) des gesamten zurückliegenden Monats. Das Durchschnittsergebnis eines Monats kommt dadurch zustande, dass alle Sonntagsfragen eines Monats mit hineinfließen, das ergibt sich den Gesamtwert. In diesem Fall lag noch bis Monatsmitte des Junis die SPD vor der AfD, erst in der zweiten Hälfte des Monats schob sich die AfD - mal höher, mal niedriger - vor die SPD.
Dennoch hatten die einzelnen Institute auch unterschiedlich Werte. So bekam die AfD bei KANTAR erst ab der Umfrage vom 24. Juni höhere Werte als die SPD, bei FORSA war das schon am 13. Juni zu erkennen. Das GMS-Institut hatte sogar am 6. Juni die AfD vor der SPD und YouGOV meldete bereits am 12. Mai, dass die AfD einen, wenn auch leichten, Vorsprung vor der SPD hatte.
Bei der Höhe der AfD-Vorsprünge vor de SPD sind im Laufe der Zeit größer geworden. Bewegen sich diese im Rahmen von etwa einem Prozentpunkt, so sind sie mit 3 %-Punkten bei GMS und YouGOV am höchsten.
Ob sich diese Werte insgesamt verfestigen und bis zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 2025 weiter fortsetzten, bleibt allerdings fraglich. Inmitten einer Bundestagswahlperiode gibt es den sog. „Oppositionseffekt“, bei dem die im Bundestag in Opposition befindlichen Parteien bei demoskopischen Daten und auch der Bundestagswahl nachfolgenden Landtagswahlen recht gut mobilisieren können. Und diese augenblicklichen demoskopischen Werte schlagen sich auch diesmal nieder.
Sonntagsfragen-Durchschnitt im Juni 2023: AfD jetzt gleichauf mit der SPD
Berlin, 1. Juli 2023: Die Umfragen der zweiten Hälfte im Juni 2023 deuteten es schon an: die AfD legt im Durchschnitt der „Sonntagsfragen“ („Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?“) im Vergleich zum Mai 2023 um 2,5 %-Punkte zu auf jetzt 18,9 %. Im Vergleich zum Ergebnis der letzten Bundestagswahl sind es sogar 8,6 %-Punkte. Damit ist die AfD genauso stark in den Umfragen wie die SPD.
Die Sozialdemokraten erreichen also ebenfalls 18,9 % (- 6,8 %-Pkte.), die CDU/CSU liegt diesen Monat bei 27,7 % (+ 3,6 %-Pkte.), fällt jedoch im Vergleich zum Vormonat um 1,2 %-Pkte. zurück. Dennoch liegen die Unionsparteien im Monat Juni insgesamt 8,8 Prozentpunkte vor der SPD. Den höchsten Vorsprung verzeichnet die Union beim Institut für Demoskopie in Allensbach, sowie bei Infratest-Dimap und GMS mit 11 bzw. 12 %-Pkte. den geringsten bei INSA-Consulere mit zum Teil nur 6 %-Pkte. Vorsprung.
Die FDP kommt in diesem Monat auf 7,1 %, sie verlöre im Vergleich zur Bundestagswahl 4,4 %-Pkte. wobei sie bei INSA-Consulere mit 7,9 sowie beim IfD mit 8 % am besten abschneidet.
Bündnis 90/Die Grünen erzielt 14,3 %, was einen Verlust von 0,5 %-Pkte. ausmachen würde. Bei INSA-Consulere erreichen die Grünen im Durchschnitt der 8 Erhebungen des Instituts im vergangenen Monat im Schnitt 13,2 % und damit nach YouGOV (13 %) den zweitniedrigsten Wert.
Die LINKE schließlich kommt im Juni auf durchschnittliche 4,5 %, bei YouGOV erreicht diese Partei immerhin 6 % und damit sogar mehr als die FDP (5 %). Die LINKE ist aber nur bei 10 der 23 Erhebungen oberhalb bzw. genau bei 5 %, alle anderen Werte liegen bei 4 - 4,5 %.
Die drei Parteien, die die Bundesregierung stellen (SPD, FDP und GRÜNE), erzielen durchschnittliche 40,2 %. Die Opposition von CDU/CSU, AfD und LINKE kommt derzeit auf 51,1 %. Wenn die LINKE den Einzug in den Bundestag verfehlen würde, hätten Unionsparteien und AfD zusammen 46,6 %, also 6,4 Prozentpunkte mehr als die derzeitige Regierungskoalition.
Das würde zu folgender Mandatsverteilung führen: Die SPD käme den Umfragen zufolge auf 137 Mandate, die Unionsparteien auf 201, die Grünen erreichen 104 Mandate, die FDP 51 und die AfD erzielt 137, die LINKE keinen Sitz.
Zur Erklärung: Es handelt sich bei dieser Rangliste nicht um eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, sondern dem Durchschnittswert, der sich aus der Berechnung der veröffentlichten Umfragedaten eines gesamten Monats der Institute Kantar, Infratest-Dimap, INSA-Consulere, der Forschungsgruppe Wahlen e. V., dem FORSA-Institut, GMS und dem Institut für Demoskopie (Allensbach) sowie YouGOV ergibt.
AfD-Kandidat Sesselmann gewinnt die Stichwahl zum Landrat in Sonneberg
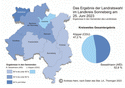 Sonneberg, 26. Juni 2023: Wie allgemein durchaus erwartet (oder sogar befürchtet, je nach politischer Präferenz), kann der Thüringer AfD-Landtagsabgeordnete Robert Sesselmann die Landratswahl (Stichwahl) im Landkreis Sonneberg für sich entscheiden. Er erzielt gegenüber dem CDU-Kandidaten Jürgen Köpper eine Mehrheit von 52,8 %, Köpper erreicht 47,2 %.
Sonneberg, 26. Juni 2023: Wie allgemein durchaus erwartet (oder sogar befürchtet, je nach politischer Präferenz), kann der Thüringer AfD-Landtagsabgeordnete Robert Sesselmann die Landratswahl (Stichwahl) im Landkreis Sonneberg für sich entscheiden. Er erzielt gegenüber dem CDU-Kandidaten Jürgen Köpper eine Mehrheit von 52,8 %, Köpper erreicht 47,2 %.
Von den acht Gemeinden des Landkreises kann Köpper sich nur in der Gemeinde Lauscha mit 53,6 % zu 46,4 Prozent gegenüber Sesselmann durchsetzen. Das höchste Ergebnis erzielt der AfD-Kandidat in der Gemeinde Goldisthal mit 61 %, das zweithöchste in der Stadt Steinach mit 59,2 %.
Die Wahlbeteiligung ist gegenüber dem ersten Wahlgang am 11. Juni massiv gestiegen auf 59,6 % (von vorher 49,1 %). Der Kandidat Köpper konnte aber dennoch mobilisieren, auch die LINKE hatte zur Stichwahl ihre Anhängerschaft aufgefordert, den CDU-Kandidaten zu unterstützen. Ebenso taten das die Kandidaten der anderen Parteien.
Jetzt stellt sich die Frage, wer wirklich von der zusätzlichen Mobilisierung von ehemaligen Nichtwählern des erstens Wahlgangs profitierte. Vergleicht man aber die absoluten Zahlen der beiden Wahlgänge, so konnte Sesselmann rund 5000 Stimmen gegenüber dem ersten Wahlgang zulegen, bei Köpper sind es rund 4000 Stimmen.
AfD laut INSA und FORSA im Osten Deutschlands stärkste Kraft
Berlin, 8.Juni 2023: In den beiden Umfragen der Meinungsforschungsinstitute INSA-Consulere und FORSA ist die rechtpopulistische „Alternative für Deutschland“ (AfD) inzwischen – demoskopisch – deutlich stärkste Partei. So kommt die AfD bei FORSA, laut Meldung im Düsseldorfer „Handelsblatt” vom 7. Juni 2023, in den östlichen Bundesländern auf 32 %. Zweitstärkste Kraft wäre dort laut Erhebung mit 23 % die CDU.
Beim Erfurter INSA-Institut erzielt die AfD im Osten immerhin noch 28 %, die CDU ist deutlich stärker als bei FORSA und käme laut INSA auf ca. 26 -27 %. Auf wenn die unterschiedlichen Werte bei der AfD und bei der CDU doch deutlich sind, so ist dieses auch auf die statistischen Schwankungsbreiten von plus-minus 3 %-Punkte geschuldet.
Immerhin aber sind sich auch andere Institute bei den hohen demoskopischen Werten der AfD einig: So erzielt sie sowohl bei INSA wie auch Infratest-Dimap bundesweit gleiche Werte (jeweils 18 %), beim GMS-Institut liegt sie mit 19 % sogar einen Punkt vor der SPD, und genauso bei YouGOV..
Auch wenn diese Werte für die AfD, die von Verfassungsschützern als „rechtsextremistischer Verdachtsfall“ eingestuft wird, recht hoch sind, so scheinen die Vertreter der etablierten Parteien recht ideenlos, was die Bekämpfung derlei Parteien - insbesondere der AfD - anbelangt. In früheren Jahren erlebten Parteien wie die Republikaner in den neunziger Jahren, ebenso wie die DVU sowie auch hin und wieder die NPD (diese z. B. vor allem in den sechziger Jahren) nach hohen Wahlergebnissen beispielsweise bei Landtagswahlen auch wieder deutliche Rückgänge in bei den Stimmergebnissen. Die AfD scheint sich dagegen wohl etabliert zu haben und ist zu einem (vorläufig) festen Bestandteil des bundesdeutschen Parteiensystems geworden, sie ist als bisher einzige rechtsgerichtete Partei in den Bundestag eingezogen..
Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern ist sie also besonders verankert. Und dabei scheint es den die AfD wählenden Personen auch ziemlich gleichgültig zu sein, wenn andere Parteien bzw. deren Angehörige die Menschen immer wieder auf rechtsextremistischen Aussagen, zum Beispiel des Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke, hinweisen, so scheinen die AfD-Anhänger gegenüber derlei Kritik taub.
Wie sich die AfD entwickelt, bleibt daher abzuwarten, denn alle Versuche, diese rechtsextreme Partei mit dem Gedankengut der NSDAP gleichzusetzen, scheint am Widerstand der AfD-Anhängerschaft zu scheitern. Zudem steht ein nicht gerade niedriger Anteil der Bevölkerung Diskussionen um Geschlechter und Diversifizierung derselben sowie den Ideen und Forderungen der „Politischen Korrektheit“ eher distanziert – zumindest desinteressiert - gegenüber.
Monats-Sonntagsfragen im Mai: Weiterer Rückgang bei Grünen und Anstieg bei der AfD
Berlin, 1. Juni 2023: In den 25 „Sonntagsfragen“ der acht führenden Institute zeigt sich der doch inzwischen deutliche - demoskopische - Rückgang bei Bündnis ´90/Die Grünen. Mit durchschnittlichen 15,1 % liegt diese Partei nur noch 0,3 %-Punkte oberhalb ihres letztmaligen Bundestagswahlergebnisses. Vor genau einem Jahr überschritten die Grünen die 20-%-Marke um 0,2 %-Punkte, im Juni 2022 erreichte die Partei sogar 22,1 %, ab September 2022 aber ging es wieder zurück.
Im selben September erzielte die AfD das erste Mal in den Umfragen wieder deutlichere Zugewinne, im Mai 2023 liegt sie bei rekordverdächtigen 16,4 % und könnte somit zu ihrem Bundestagswahlergebnis von 2021 6,1 %-Punkte (also ca. 59 %) hinzugewinnen.
Ebenfalls, im Mai wieder deutlicher, liegt die SPD mit 18,8 % (- 6,9 %-Pkte.) unterhalb der 20-%-Marke, während die CDU und CSU zusammen auf 28,9 % kommen. Dabei unterscheiden sich die Daten für die Union bei den einzelnen Instituten zum Teil deutlich: beim Allensbacher Institut für Demoskopie erzielt die Union 32 %, beim Erfurter Institut INSA-Consulere kommt die Union nicht an die 30 % heran, sie liegt dort zwischen 27 und 28 %.
Die FDP erzielte im Mai wieder etwas mehr als in den Vormonaten, sie kommt im Mittel auf 7,7 % (- 3,8 %-Punkte), die LINKE erreicht 4,7 % (- 0,2 %-Punkte).
Die drei Parteien, die die Bundesregierung stellen (SPD, FDP und GRÜNE), erzielen durchschnittliche 41,6 %, sie würden 10,4 %-Punkte verlieren im Vergleich zum letzten Bundestagswahlergebnis vom September 2021. Die Opposition von CDU/CSU, AfD und LINKE kommt derzeit auf 50,0 %. Wenn die LINKE den Einzug in den Bundestag verfehlen würde, hätten Unionsparteien und AfD zusammen 45,3 %, also 3,7 Prozentpunkte mehr als die derzeitige Regierungskoalition.
Das würde zu folgender Mandatsverteilung führen: Die SPD käme den Umfragen zufolge auf 136 Mandate, die Unionsparteien auf 210, die Grünen erreichen 109 Mandate, die FDP 56 und die AfD erzielt 119 und die LINKE keinen Sitz.
Zur Erklärung: Es handelt sich bei dieser Rangliste nicht um eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, sondern dem Durchschnittswert, der sich aus der Berechnung der veröffentlichten Umfragedaten eines gesamten Monats der Institute Kantar, Infratest-Dimap, INSA-Consulere, der Forschungsgruppe Wahlen e. V., dem FORSA-Institut und dem Institut für Demoskopie (Allensbach) sowie YouGOV ergibt.
Bürgerschaftswahl in Bremen: SPD wieder an erster Stelle im Parteienranking
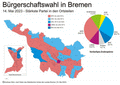 Bremen, 14. Mai/19. Mai 2023: Das vorläufige amtliche Endergebnis, veröffentlicht vom Statistischen Landesamt Bremen (Stand: 19. Mai), zeigt folgende Zahlen: Die mit Bürgermeister Bovenschulte regierende SPD kommt demnach auf 29,8 % (+ 4,9 %-Punkte im Vergleich mit dem Ergebnis von 2019), die CDU fällt leicht zurück auf 26,2 % (- 0,5 %-Pkte.), die LINKE erreicht in etwa ihr vorheriges Ergebnis mit 10,9% (- 0,4 %-Pkte.), Bündnis 90/Die Grünen kommt auf 11,9 % (- 5,5 %-Pkte.) die FDP erreicht 5,1 % (- 0,8 %-Pkte.). Die rechtskonservative Partei BIW („Bürger in Wut“) erzielt ein Ergebnis von 9,4 % (+ 7,0 %-Pkte.), diese Partei dürfte davon profitiert haben, dass die AfD zur Wahl nicht zugelassen wurde. Auf alle anderen Parteien entfallen 6,7 %. Die Wahlbeteiligung beträgt 56,7 % (- 7,3 %-Pkte.).
Bremen, 14. Mai/19. Mai 2023: Das vorläufige amtliche Endergebnis, veröffentlicht vom Statistischen Landesamt Bremen (Stand: 19. Mai), zeigt folgende Zahlen: Die mit Bürgermeister Bovenschulte regierende SPD kommt demnach auf 29,8 % (+ 4,9 %-Punkte im Vergleich mit dem Ergebnis von 2019), die CDU fällt leicht zurück auf 26,2 % (- 0,5 %-Pkte.), die LINKE erreicht in etwa ihr vorheriges Ergebnis mit 10,9% (- 0,4 %-Pkte.), Bündnis 90/Die Grünen kommt auf 11,9 % (- 5,5 %-Pkte.) die FDP erreicht 5,1 % (- 0,8 %-Pkte.). Die rechtskonservative Partei BIW („Bürger in Wut“) erzielt ein Ergebnis von 9,4 % (+ 7,0 %-Pkte.), diese Partei dürfte davon profitiert haben, dass die AfD zur Wahl nicht zugelassen wurde. Auf alle anderen Parteien entfallen 6,7 %. Die Wahlbeteiligung beträgt 56,7 % (- 7,3 %-Pkte.).
Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF veröffentlichten auch zu dieser Wahl wieder Daten, die sie zum Teil aus den Wahltagsbefragungen sowie aus Befragungen vor der Wahl (durch die Institute Infratest-Dimap und Forschungsgruppe Wahlen e. V.) gewinnen konnten.
Demnach ist der Sieg der SPD in Bremen heutzutage nicht mehr selbstverständlich, sondern vor allem auf die Beliebtheit ihres Spitzenkandidaten Bovenschulte zurück zu führen. Zudem sind die gut 30 % der SPD im Vergleich mit früheren Ergebnissen in dem Bundesland (z. B. 1971: 55,3 %) eher mager. Jedenfalls ermittelte die Forschungsgruppe Wahlen (FGW), dass Bovenschulte von gut 60 % der Befragten vor seinem Kontrahenten von der CDU – Imhoff - (23 %) bevorzugt wurde. Sieht man hingegen den Vergleich zwischen SPD und Bovenschulte bei der Frage „wer kann Bremen erfolgreich in die Zukunft führen“, die höchst unterschiedlichen Werte für die SPD und ihrem Spitzenkandidaten. Bovenschulte trauen das 45 % zu, der SPD, nur 29 %.
Dennoch sind bei den Bewertungen der Parteien im Land Bremen auch Auffälligkeiten zu finden: Die SPD kommt laut der Forschungsgruppe Wahlen mit einem guten Wert von 1.6 bewertet, die CDU auf 0.6, die Grünen aber auf - 0.6.
Bei den Parteienkompetenzen liegt, so Infratest-Dimap, die SPD in ihrem klassischen Feldern „Soziale Gerechtigkeit“ und „Arbeitsplätze sichern“ mit 33 bzw. 32 % vorn. Die CDU in Bremen kann mit 32 % beim Thema „Wirtschaft“ punkten (32 %), büßt hier aber massiv (- 12 %-Pkte.) ein, beim Thema „Finanzpolitik“ (27 %) verliert sie ebenfalls (- 10 %-Pkte.).
Die Bremer Grünen mussten einen massiven Rückgang in der Kompetenzzuweisung „Umwelt- und Klimapolitik“ hinnehmen von – 24 %-Pkten., während die SPD hierbei um 10 %-Pkte. Zulegen kann.
CDU und SPD sind in Bremen vor allem von den in der Altersgruppe von über 60 Jahren (SPD: 38 %, CDU: 29 %) gewählt worden, LINKE, GRÜNE und FDP mehr von der Altersgruppe der unter 30-jährigen (17 %, 19 % und 7 %). Die BIW ist in der Altersgruppe von 45 bis 59 Jahren (13 %) sowie in der Berufsgruppe der Arbeiter (20 %) erfolgreich.
Kommentar: Nachdem die Grünen in den letzten Jahren von Wahl zu Wahl in demoskopische bzw. elektorale Hochflüge aufstiegen, so bedeutet dieses Ergebnis einen deutlichen Verlust für diese Partei. Schon seit geraumer Zeit steht der von den Grünen gestellte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in der öffentlichen Kritik.
Für die CDU bedeutet diese Wahl in Bremen ein Rückschlag, nachdem sie im Frühjahr bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl um 10 %-Punkte zulegte und 2019 die Bremer CDU erstmals stärkste Partei bei einer Bremer Bürgerschaftswahl wurde.
Allerdings lassen sich diese regionalen Ergebnisse nicht 1 zu 1 auf die demoskopische Bundesstimmung übertragen. In Berlin war die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) recht mau in der öffentlichen Beurteilung. In Bremen wird der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, Bovenschulte, laut Infratest-Dimap wesentlich besser beurteilt wird als Giffey (Frage: „Guter Ministerpräsident“ Bovenschulte: 64 %, Giffey: 36 %).
Zudem sieht das Ergebnis der Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein, welche auch am 14. Mai stattfanden, anders aus: Hier ist die SPD auf nur noch 19,4 Prozent gekommen, in der Landeshauptstadt Kiel musste sie sogar den ersten Rang an die Grünen (27,1 %) abgeben. Auch hier sind regionale Ergebnisse nicht auf die Bundespolitik zu übertragen. Allerdings zeigt es ja, dass das Bremer Ergebnis jedenfalls unter regionalen Gesichtspunkten zu sehen ist.
Sonntagsfragen-Durchschnitt im April 2023: Weiterer Rückgang bei Bündnis 90/Die Grünen und SPD
Berlin, 30. April/1. Mai 2023: Der Durchschnitt der 24 „Sonntagsfragen“ („Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?“) des Monats zeigt einen leichten Einbruch in der politischen Präferenz für die CDU und CSU. Derzeit würden sie zusammen auf 28,7 Prozent kommen. Das wäre ein – zumindest theoretischer - Zugewinn von 4,6 %-Punkten zu ihrem letztmaligen Bundestagswahlergebnis. Im März hatte der Durchschnitt für die Union noch 29 % betragen.
Etwas stärker jedoch, nämlich um 0,5 %-Punkte im Vergleich mit dem Durchschnitt des Monats März, verlor die SPD, die jetzt etwa 19,4 % erreichen würde. Damit würde sie insgesamt 6,3 %-Punkte im Vergleich mit dem letzten Bundestagswahlergebnis vom Herbst 2021 einbüßen.
Ebenso würde die Partei Bündnis90/Die Grünen im Vergleich zum Vormonat Einbußen von 0,5 %-Punkte verzeichnen (auf jetzt 16,3 %) läge aber immer noch um 1,5 %-Punkte über ihrem Bundestagswahlergebnis.
Die FDP, die im März auf durchschnittliche 6,7 % gekommen war und nahezu 5 %-Punkte unterhalb ihres Bundestagswahlergebnis gelegen hatte, erreicht wieder einen Anstieg in der Sonntagsfragen-Wahlabsicht auf 7,4 %. Sie würde zwar 4,1 %-Punkte im Vergleich zu ihrem Bundestagswahlergebnis einbüßen, sie wäre aber sicher im Bundestag.
Die AfD kommt im April auf durchschnittliche 15,4 % und gewänne (theoretisch) 5,1 %-Punkte hinzu. Dabei schwankt die AfD - je nach Angaben der Institute - zwischen 17 % (YouGOV) und 14 % bei KANTAR und FORSA.
Die LINKE liegt im April bei durchschnittlichen 4,4 %, also genau so wie im Durchschnitt des Monats April 2022. Zwischendurch war sie auf 5 % gekommen (Januar 2023), geht derzeit aber wieder zurück. Die Frage ist vor allem für diese Partei, ob sie es schafft, sich wieder dauerhaft oberhalb von 5 % einzupendeln, da im neuen Wahlrecht die Sperrklausel von 5 % verschärft wurde. Die LINKE liegt bei 13 der 24 Sonntagsfragen bei 4 %, nur in 6 davon erreicht sie 5 %, in einer (YouGOV) kommt sie auf 6 %.
Die drei Parteien, die die Bundesregierung stellen (SPD, FDP und GRÜNE), erzielen durchschnittliche 43,1 %. Die Opposition von CDU/CSU, AfD und LINKE kommt derzeit auf 48,5 %. Wenn die LINKE den Einzug in den Bundestag verfehlen würde, hätten Unionsparteien und AfD zusammen 44,1 %, also einen Prozentpunkt mehr als die derzeitige Regierungskoalition.
Das würde zu folgender Mandatsverteilung führen: Die SPD käme den Umfragen zufolge auf 140 Mandate, die Unionsparteien auf 207, die Grünen erreichen - theoretisch - 118 Mandate, die FDP 54 und die AfD erzielt 111 und die LINKE keinen Sitz.
Zur Erklärung: Es handelt sich bei dieser Rangliste nicht um eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, sondern dem Durchschnittswert, der sich aus der Berechnung der veröffentlichten Umfragedaten eines gesamten Monats der Institute Kantar, Infratest-Dimap, INSA-Consulere, der Forschungsgruppe Wahlen e. V., dem FORSA-Institut, GMS und dem Institut für Demoskopie (Allensbach) sowie YouGOV ergibt.
Ergebnis Salzburger Landtagswahl: KPÖ und FPÖ legen zu
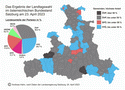 Salzburg, 23. April 2023: Während die Parteien ÖVP und SPÖ im österreichischen Bundesland Salzburg zusammen fast 10 %-Punkte bei der heutige Landtagswahl einbüßten im Vergleich zum Ergebnis von 2018 (ÖVP: - 7,4 %-Punkte, SPÖ: - 2,2 %-Punkte), legten die FPÖ und vor allem die österreichische KPÖ-Plus (Kommunistische Partei Österreichs) massiv an Stimmen zu.
Salzburg, 23. April 2023: Während die Parteien ÖVP und SPÖ im österreichischen Bundesland Salzburg zusammen fast 10 %-Punkte bei der heutige Landtagswahl einbüßten im Vergleich zum Ergebnis von 2018 (ÖVP: - 7,4 %-Punkte, SPÖ: - 2,2 %-Punkte), legten die FPÖ und vor allem die österreichische KPÖ-Plus (Kommunistische Partei Österreichs) massiv an Stimmen zu.
Die FPÖ ist zweitstärkste Partei in dem Bundesland mit jetzt 25,7 % (+ 6,9 %-Punkte), die KPÖ-Plus mit 11,7 Prozent (+ 11,3 %-Punkte) auf dem vierten Platz des Bundeslandes. Die ÖVP erzielt mit 30,4 % den ersten Platz, die SPÖ liegt mit 17,4 % jetzt auf dem dritten Platz.
Ebenfalls büßten die Partei NEOS (- 3,1 %-Punkte) und die österreichischen GRÜNEN (- 1,1 %-Punkte) an Anteilen ein. Da in dem Bundesland die 5-%-Hürde gilt, fällt die Partei NEOS aus dem Landtag. Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich mit dem Ergebnis von 2018 auf 70,9 % von vorher 65 % angestiegen.
Laut erster Analysen des SORA-Instituts für den ORF kann die FPÖ von der ÖVP Stimmen zu sich herüberziehen, während die KPÖ vor allem von der SPÖ sowie den Grünen und ehemaligen Nichtwählern gewinnen kann.
Durchschnitt bei der „Sonntagsfrage“ im März 2023: Anstieg bei der Union und Rückgang bei SPD und Grünen
Berlin, 31. März/ 1. April 2023: Der Durchschnitt der 23 „Sonntagsfragen“ („Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?“) zeigt im März dieses Jahres einen weiteren Anstieg in der politischen Präferenz für die CDU und CSU. Derzeit würden sie zusammen auf 29 Prozent kommen. Das wäre ein – theoretischer - Zugewinn von 4,9 %-Punkten.
Die derzeit zusammen mit Bündnis 90/Die Grünen und der FDP im Bund regierenden SPD würde wieder unter die 20-%-Marke geraten und erreicht nur 19,9 % (- 5,8 %-Punkte). Gewinne bei der Union und Verluste bei der SPD in diesem Monat lassen sich, wenn auch nur bedingt, mit dem „Oppositionseffekt“ innerhalb der Wahlperioden des Bundestags erklären, bei dem die im Bund befindliche Opposition bei den der Bundestagswahl folgenden Landtagswahlen oftmals mobilisieren kann. So legte die CDU bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin im Februar massiv zu, während SPD sowie auch die FDP massive Einbußen erlitten.
Bündnis 90/Die Grünen liegt im März-Durchschnitt bei 16,8 % und etwas niedriger als im Februar. Seit dem Sommer 2022 hat die Partei rund 6 %-Punkte im Umfragedurchschnitt verloren, sie läge aber noch 2 %-Punkte oberhalb des Bundestagswahlergebnisses.
Die FDP verliert weiterhin und kommt im März auf durchschnittliche 6,7 %. Es ist anzunehmen, dass sie einerseits an die Union abgegeben hat, aber auch an die AfD. Diese legt wiederum zu und erreicht im März 14,9 %. Damit ist diese rechtspopulistische Partei kaum noch aus dem Parteiensystem Deutschlands wegzudenken.
Die LINKE hingegen liegt auch im März bei 4,9 %, also genau bei ihrem Ergebnis der letzten Bundestagswahl. Durch das neue Wahlrecht für den Bundestag, welches Mitte des vergangenen Monats beschlossen wurde, könnte sie nicht mit drei Direktmandaten in den Bundestag einziehen, sie wäre demnach außen vor. Aber von den 23 Sonntagsfragen aber erhält sie bei 17 davon Ergebnisse oberhalb von 5 %, sie könnte zumindest darauf hoffen, die 5-%-Hürde zu überspringen.
Die drei Regierungsparteien erzielen Ende März gemeinsam rund 43 %, während die drei Oppositionsparteien auf fast 49 % kommen. In Mandate umgerechnet hätte die SPD 144, die Grünen 121, die FDP 48, die CDU/CSU 209 und die AfD 108. Damit hätten Union und die AfD zumindest theoretisch eine Mandatsmehrheit, obwohl beide das ausschließen.
Zur Erklärung: Es handelt sich bei dieser Rangliste nicht um eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, sondern dem Durchschnittswert, der sich aus der Berechnung der veröffentlichten Umfragedaten eines gesamten Monats der Institute Kantar, Infratest-Dimap, INSA-Consulere, der Forschungsgruppe Wahlen e. V., dem FORSA-Institut und dem Institut für Demoskopie (Allensbach) sowie YouGOV ergibt.
Ergebnis der Stichwahl zum Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt/Main: SPD stellt dem nächsten Amtsinhaber
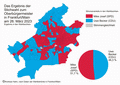 26. März 2023: Nachdem der vorherige Oberbürgermeister, Peter Feldmann (SPD), in der größten Stadt in Hessen, Frankfurt/Main, im November 2022 mit einem Anteil von über 95 % abgewählt wurde, wurden am 12. März sowie heute am 26. März die beiden (Neu-)Wahlen für das Amt des Oberbürgermeisters durchgeführt.
26. März 2023: Nachdem der vorherige Oberbürgermeister, Peter Feldmann (SPD), in der größten Stadt in Hessen, Frankfurt/Main, im November 2022 mit einem Anteil von über 95 % abgewählt wurde, wurden am 12. März sowie heute am 26. März die beiden (Neu-)Wahlen für das Amt des Oberbürgermeisters durchgeführt.
Im ersten Wahlgang am 12. März lag der Kandidat der Frankfurter CDU, Uwe Becker, mit 34,5 % mehr als 10 %-Punkte vor dem jetzt gewählten Kandidaten der SPD, Mike Josef, der bei dieser Stichwahl auf 51,7 % gekommen ist, Uwe Becker erreichte 48,3 %. Beim ersten Wahlgang beteiligten sich 40,4 %, heute waren es nur noch 35,4 %.
Josef kam in 229 der 376 Frankfurter Wahlbezirke auf eine Mehrheit, Becker erzielte in 145 Wahlbezirken eine Mehrheit, in zweien kamen beide auf genau das gleiche Wahlergebnis.
Landtagswahl in Kärnten: Die SPÖ bleibt bei Verlusten von 9 %-Punkten stärkste Partei
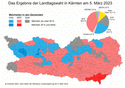 Klagenfurt, 5. März 2023: Vor 5 Jahren konnte die SPÖ in Kärnten die Hälfte der insgesamt 36 Landtagsmandate für sich verbuchen. Zu diesem Zeitpunkt stieg die Partei auf 47,9 % der Stimmen und konnte damit fast an ihre alten Ergebnisse in dem Bundesland Österreichs wieder anschließen. So kam die SPÖ z. B. bei der Landtagswahl des Jahres 1984 noch auf 51,7 %.
Klagenfurt, 5. März 2023: Vor 5 Jahren konnte die SPÖ in Kärnten die Hälfte der insgesamt 36 Landtagsmandate für sich verbuchen. Zu diesem Zeitpunkt stieg die Partei auf 47,9 % der Stimmen und konnte damit fast an ihre alten Ergebnisse in dem Bundesland Österreichs wieder anschließen. So kam die SPÖ z. B. bei der Landtagswahl des Jahres 1984 noch auf 51,7 %.
Danach aber verlor die Partei massiv an Stimmen und Mandaten, ab 1999 war dann die FPÖ mit ihrem Landeshauptmann (Ministerpräsident) Jörg Haider die stimmenstärkste Partei (42,1 %). 2004 wiederholte die FPÖ ihren Wahlerfolg, 2009 übernahm das von Jörg Haider gegründete, gleichfalls wie die FPÖ rechtspopulistische „Bündnis Zukunft Österreich“ das Ruder, obwohl Haider im Oktober 2008 bei einem Autounfall ums Leben kam. Dessen Nachfolger im Amt wurde dann Gerhard Dörfler.
Das BZÖ-Kärnten vereinigte sich danach wieder mit der FPÖ und trat an als „Die Freiheitlichen Kärnten“ (FPK). Diese war dann 2012 in einen Korruptionsskandal verwickelt, sodass es 2013 zu einer Neuwahl des Landtags gekommen war. Diese Wahl konnte die SPÖ für sich entscheiden und stellt seitdem mit Peter Kaiser auch den Landeshauptmann.
Bei der heutigen Wahlentscheidung kommt die SPÖ auf 38,9 %, die FPÖ erreicht 24,6 %, die konservative ÖVP erzielt 17 % und das Kärntner „Team Köfer“ 10,1 %. Die Grünen und das Bündnis NEOS erreichen mit 3,9 bzw. 2,6 % keine Landtagsmandate. Die Wahlbeteiligung stieg an von 68,6 auf 71,4 %.
Die SPÖ schnitt bei den Erwerbstätigen des Bundeslandes mit gut 34 % etwas unter dem Durchschnitt ab, während die FPÖ in dieser Gruppe auf 30 % kommt, so das „SORA-Institut“, welches die Hochrechnungen für den ORF durchführt. Interessant ist, dass die SPÖ besonders gut abschneidet bei Menschen mit einem Universitäts-Abschluss. Die SPÖ erreicht hier 49 %.
Die FPÖ erzielt ausgesprochen hohes Ergebnis bei Männern ohne „Matura“, einem dem deutschen Abitur gleichwertigen Schulabschluss, mit 32 %. Erwerbstätige ohne Matura wählten sogar zu 34 % die FPÖ. Diejenigen, die angaben, mit ihrem Einkommen gut auszukommen, wählten in Kärnten zu 40 % die SPÖ, diejenigen, die angegeben haben, schlecht mit ihrem Einkommen zurecht zu kommen, wählten zu 33 % die FPÖ.
Und auch die Skepsis gegenüber der Kärntner Politik spielt bei der Wahlentscheidung eine Rolle. Bei den Menschen, die „kein Vertrauen in die Kärntner Politik“ angeben, kommt die FPÖ auf 37 % sowie das Team Köfer auf 17 %, während die SPÖ hier nur 18 % erzielt. Im Gegensatz dazu steht das „Vertrauen in die Kärntner Politik“ und einem SPÖ-Anteil von 50 %. Das Ergebnis ist also erneut eine Mischung aus Zustimmung und Skepsis, wobei vom letztgenannten die FPÖ profitieren kann.
Durchschnitt bei der „Sonntagsfrage“ im Februar: Union und SPD legen nur leicht zu
Berlin, 1. März 2023: Im Februar 2023 gab es neben der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus auch insgesamt 22 mal die Sonntagsfrage zur Bundestagswahlabsicht. In beiden Fällen hatte die CDU (im Bund: CDU/CSU) die Nase vorn.
Liegt die Union bei Infratest-Dimap, der Forschungsgruppe Wahlen und GMS etwa 10 %-Punkte vor der SPD, waren es bei FORSA sogar bis zu 12 %-Punkte. Beim INSA-Institut betrug die Differenz zugunsten der CDU/CSU gegenüber der SPD etwas weniger, so zwischen 6 und 8 %-Punkte.
Bündnis 90/Die Grünen ist bei INSA am niedrigsten gewertet mit aktuell 15,5 %, gleichauf mit der AfD. Bei KANTAR und der Forschungsgruppe Wahlen liegen die Grünen zeitweise bei bis zu 19 %, die AfD kam bei YouGOV mit 17 % auf den höchsten Wert, bei FORSA wurde diese Partei bei nur 13 % gesehen.
Dahingegen sind die beiden kleineren Parteien FDP und LINKE weitgehend im Durchschnitt des Monats, entweder 4 – 6 % (LINKE) bzw. 5 – 8 % (FDP).
Insgesamt liegt die CDU/CSU bei 28,3 % (was einen theoretischen Zugewinn von 4,2 %-Punkte zum Bundestagswahlergebnis ausmachen würde), die SPD kommt auf durchschnittliche 20,5 % (- 5,2 %-Punkte). Bündnis 90/Die Grünen erzielen 17 % (+ 2,2 %-Punkte), die FDP kommt auf 6,8 % (- 4,7 %-Punkte), die AfD erzielt im Durchschnitt 14,8 % (+ 4,5 %-Punkte) und die LINKE wird wieder bei ca. 4,9 % (+/- 0,0 %-Punkte) gesehen.
In Bundestagssitze umgerechnet, ohne Überhang- und Ausgleichsmandate, würde die SPD 140 Mandate erzielen, die CDU/CSU käme auf 193 Sitze, die Grünen auf 116, die FDP auf 46, die AfD würde 101 Sitze bekommen und die LINKE käme auf 2 (Direkt-) Mandate.
Zur Erklärung: Es handelt sich bei dieser Rangliste nicht um eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, sondern dem Durchschnittswert, der sich aus der Berechnung der veröffentlichten Umfragedaten eines gesamten Monats der Institute Kantar, Infratest-Dimap, INSA-Consulere, der Forschungsgruppe Wahlen e. V., dem FORSA-Institut, GMS und dem Institut für Demoskopie (Allensbach) sowie YouGOV ergibt.
Das vorl. amtliche Endergebnis der Abgeordnetenhauswahl in Berlin - Die CDU liegt vorn
Berlin, 13. Februar 2023: Die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist entschieden worden: Die CDU liegt mit 28,2 % der Zweitstimmen recht deutlich vor der politischen Konkurrenz. Die SPD kommt, wie Bündnis 90/Die GRÜNEN auf 18,4 %, mit etwa 105 Stimmen mehr als diese. Die LINKE erzielt dieses Mal 12,2 %, die AfD erreicht 9,1 %, die FDP fällt aus dem Parlament mit 4,6 %. Alle anderen Parteien erzielen 9,1 Prozent.
Dass die bislang regierende Koalition in Berlin unter Führung der SPD Verluste einfahren würde, hatten schon Umfragen im Vorfeld angedeutet. Interessant dabei ist, dass das Abschneiden der CDU als zu niedrig eingeschätzt wurde, die SPD aber etwas zu hoch. Negativ schnitt dabei dieses Mal die Forschungsgruppe Wahlen, die für das ZDF die Wahlanalysen bereitstellt, ab. Sie hatte die SPD zuletzt, drei Tage vor dem Wahltermin, bei 21 % gesehen, die CDU bei nur 25 %, diese wurde aber auch von keinem anderen Institut mit ihrem Endergebnis eingeschätzt.
Bei den GRÜNEN lagen die Umfragen recht nahe, von den sechs „Sonntagsfragen“ seit Januar 2023 wurden diese bei vieren nahe ihres Endergebnisses, also bei 18 % eingeschätzt, bei der Forschungsgruppe Wahlen kamen die GRÜNEN zuletzt auf 17 %. Es ist also möglich, da Bündnis 90/Die GRÜNEN von den in der Stadt koalierenden Parteien mit einem eher geringen Verlust von nur einem halben Prozentpunkt davonkamen, die Daten der Sonntagsfragen ihre Klientel auch zur Wahl animierten. Ebenso kann es sich bei der SPD, nur entgegengesetzt, zugetragen haben. Deren Anhängerschaft war nur wenig zu motivieren und die mageren Umfragedaten taten ein Übriges, diesen Trend zu verstärken.
Die CDU hingegen sah sich im Aufschwung und das motivierte offenbar ihre Anhängerschaft. Sie profitierte auch von dem nach Bundestagswahlen vorherrschenden „Oppositionseffekt“, also, dass die im Bund in Opposition befindliche(n) Partei(en) bei einer Bundestagswahl nachfolgenden Landtagswahl(en) oft mobilisieren können. Und das war bei der CDU offenbar der Fall.
Ganz erheblich zeigen sich diese Ergebnis-Daten bei den Direktsitzen, die über die Erststimmen vergeben werden. Die CDU kommt bei nur 29,7 % der Erststimmen auf 48 der 78 zu vergebenden Direktmandate, davor waren es 21. Die SPD verliert dramatisch im Vergleich zu dem Ergebnis von 2021 auf jetzt 4, 2021 waren es noch 25. Die GRÜNEN, haben, obwohl sie auch bei den Erststimmen hinter der SPD liegen, immerhin 20 Direktmandate erhalten. Und auch wie die SPD erzielt die LINKE vier Direktmandate, die AfD zwei. Bemerkenswert ist es, dass die CDU-Wahlkreise sozusagen wie ein „Ring“ um die Wahlkreise der eher linken Parteien SPD, GRÜNE und LINKE verteilt sind, nur die AfD hat ihre zwei Wahlkreise außen in Marzahn-Hellersdorf.
Zudem ist nicht ein einziger Wahlkreis mit 50 % und mehr gewonnen worden. Gerade dieses Phänomen, das Fehlen von großen Mehrheiten bei der SPD oder der CDU zumeist, ist zunehmend und auffallend. Und dass die CDU so derartig ins Jubeln kommt bei ihren 28,2 %, ist auch erstaunlich. Denn z. B. 1963 lag sie bei 28,8 %, während die SPD, damals mit Willy Brandt als Regierenden Bürgermeister, auf 61,9 % gekommen ist. 1981 konnte die CDU die SPD von der Regierung in Berlin ablösen, sie erzielte damals 48 %, die SPD 38,3 %.
Im Laufe der letzten vierzig Jahre veränderte sich die Parteienlandschaft in Deutschland insgesamt, die vormals „großen Parteien“ Union und SPD sind auf gerade einmal gut die Hälfte ihre früheren Wählerschaften zusammen geschmolzen, während zum Beispiel die GRÜNEN inzwischen recht hohe Ergebnisse erzielen können.
Was war also gestern passiert? Die CDU konnte also gewinnen, im historischen Vergleich ist das Ergebnis jedoch eher mager. Magerer fiel es gestern es nur bei der SPD aus und diese hatte sich lange Zeit als „Berlin-Partei“, ein Trugschluss ohnegleichen, gesehen. Einige ihrer Funktionäre beklagten sich z. B. 1995, als es „nur“ 23,6 %, waren, 1999 kam die SPD auf 22,4 %, dann erholte sich die SPD eher leicht und stieg auf 29,7 und 30,8 %. Danach aber gingen ihre Anteile erst etwas, dann massiver zurück auf 28,3 % (2011), während die CDU in der Stadt bei 23,3 % lag und in eine Regierung mit der SPD eingetreten ist. Dieses bekam der CDU allerdings nicht so gut, denn sie brach 2016 massiv ein und kam nur noch auf 17,6 %. 2021 waren es dann 18 % für die Christdemokraten.
Die Forschungsgruppe Wahlen (FGW) und das Institut Infratest-Dimap stellen für die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender die Analysedaten zur Verfügung. Dabei wurden zum Beispiel von der FGW festgestellt, dass bei der Anhängerschaft der LINKEN nur 44 % der Ansicht sind, dass Franziska Giffey als Regierende Bürgermeisterin „ihre Arbeit gut“ erledigen würde, während es bei der SPD-Anhängerschaft immerhin 90 % sind. Selbst die CDU-Anhängerschaft (49 %) bewertet Giffeys Arbeit besser als die Anhängerschaft der LINKEN. Die Sympathiewerte von Giffey sind mit 29 % zwar höher als bei den anderen beiden wichtigsten Gegenkandidaten Wegner (CDU) und Jarasch (GRÜNE), aber auch nicht durchschlagend hoch.
Gleichauf mit Wegner liegt Giffey (jeweils 24 %) bei der Frage, wer „Berlin am ehesten in die Zukunft führen“ könne, auch kein wirklich hoher Wert. Auffallend ist auch, dass Bettina Jarasch bei der Bewertungsskala von minus 5 bis plus 5 mit – 1.3 einen recht niedrigen Wert erzielte, während Klaus Lederer von der LINKEN mit 0.5 sogar vor Franziska Giffey (0.4) und Kai Wegner (0.3) liegt. Jarasch war also wenig wahlentscheidend für die Anhängerschaft der GRÜNEN. Bei der Bewertung von Senat und Opposition in Berlin lag nur die SPD mit 0.2 und die CDU mit 0.1 im positiveren Bereich, wenn auch recht niedrig. Die GRÜNEN wurden mit – 0.9 zwar besser bewertet als die AfD (- 3.1), aber am schlechtesten von den drei Koalitionären.
Dass der Senat aus SPD, GRÜNEN und der LINKEN „seine Arbeit gut machen“ würde, meinen nur 34 %, während 57 % das anders sehen. Dass die CDU es besser machen würde, meinen es aber auch nur 29 % der von der Forschungsgruppe Wahlen befragten Personen. Anders gesagt, die 28,2 % der CDU sind evtl. „Vorschusslorbeeren“, wenn überhaupt.
Das Hauptproblem ist das Thema „Mieten und Wohnungen“ mit 39 %, gefolgt vom Thema „Verkehr“ mit 38 %. Das Thema „Kriminalität“ liegt mit nur 11 % auf dem fünften Rang. Gerade ein Sozialthema wie Wohnen kann Sprengkraft entwickeln. Und hier hat die SPD mit nur 19 % der Nennungen kaum Kompetenzzuweisungen, die CDU liegt mit 17 % und die LINKE mit 14 % dahinter. Infratest-Dimap hat zudem ermittelt, dass die LINKE mit 22 % vor der SPD wie auch vor der CDU „am ehesten für bezahlbaren Wohnraum sorgen“ würde.-
Das Thema Verkehr hingegen ist gleichwohl ein Thema der CDU wie auch der GRÜNEN (28 bzw. 22 %). Und da auch eine hohe Anzahl der SPD-Anhängerschaft sich mit ihrem Auto identifiziert, ist diese offenbar zwischen den diametralen Blöcken CDU und GRÜNE zerrieben worden. Dass zeigt sich auch in der Frage, ob denn der „Autoverkehr zugunsten der Radfahrer und Fußgänger“ eingeschränkt werden solle. Mehrheitlich wurde das abgelehnt (59 %), dabei von 53 % der SPD-Anhängerschaft und zu 80 % bei der CDU. Nur 11 % der GRÜNEN lehnt das ab.
Das Thema „Kriminalitätsbekämpfung” spielte im Wahlkampf durchaus eine wichtige Rolle, wenn auch nicht die entscheidende. Und hier führt die CDU mit 31 % an Kompetenzzuweisung vor der SPD (13 %) und auch der AfD (12 %). Im Zusammenhang mit den Krawallen in der Silvesternacht konnte die CDU gegenüber dem SPD-geführten Senat auch hier punkten.
Hohe Anteile hatte die SPD laut Umfrage von Infratest-Dimap in der Altersgruppe der über 70-jährigen. Hier erreicht sie noch 30 Prozent, während es in der Altersgruppe zwischen 25 und 34 Jahre nur 10 % sind. Im Gegensatz dazu sind es in dieser Altersgruppe 30 % für die GRÜNEN. Die CDU konnte vor allem über 11 %-Punkte in den Altersgruppen ab 45 Jahre aufwärts zulegen. Während die SPD bei den Rentnern 6 %-Punkte verlor, konnte die CDU in dieser Gruppe 12 %-Punkte zulegen.
Die SPD verlor laut Infratest-Dimap-Wählerwanderungsbilanz ca. 53000 Stimmen im Saldo an die CDU und 57000 in das Lager der Nichtwähler. Bemerkenswert ist zudem, dass die CDU von Seiten aus der LINKEN-Anhängerschaft im Saldo 10000 Stimmen zu sich rüber ziehen konnte sowie 15000 ehemalige GRÜNE-Wähler. Die LINKE gab mit 40000 Stimmen im Saldo in das Nichtwählerlager ab.
Insgesamt gesehen kann sich diese Wahl auch wieder auf die Umfragesituation bundesweit auswirken. Ob das so ist, wird sicher vom Verhalten der politisch Handelnden abhängen. So kann das Berliner Wahlergebnis trotz bundesdeutschen Oppositionseffekt als eher lokale Angelegenheit betrachtet werden.
Vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin: Wenig Überraschendes in den Umfragen – Bericht und Kommentar
Berlin, 10. Februar 2023: Die vorerst letzte Umfrage vor der am kommenden Sonntag stattfindenden Abgeordnetenhauswahl in Berlin sieht die CDU in Führung mit ca. 25 %, die Forschungsgruppe Wahlen ermittelte diesen Wert. Bei allen 6 Umfragen seit Beginn des Jahres kommt die CDU im Durchschnitt auf 24,7 Prozent, die SPD, die bei der Forschungsgruppe 21 % erzielt, liegt im Durchschnitt aller 6 „Sonntagsfragen“ bei 19,2 %. Es ist dabei interessant, dass die Sozialdemokraten in den Umfragen recht schwankend abschneiden: Beim FORSA-Institut, welches am 5. Februar die Daten veröffentlichte, kommt die Partei nur auf 17 Prozent, während die CDU mit 26 % dort den höchsten Wert verzeichnet. Die Forschungsgruppe Wahlen hat die SPD bei beiden Umfragen des Februars bei 21 %, bei Infratest-Dimap liegt die SPD in den beiden Umfragen vom 18. Januar und 2. Februar bei 18 bzw. 19 Prozent. Das INSA-Institut sah am 9. Februar die SPD bei 19 % und die CDU bei 25.
Entscheidend sind weniger die Prozente als solche, sondern inwieweit die Institute gerade bei der SPD etwas im Nebel zu stochern scheinen. Sicher aber ist: diese Partei und auch ihre Spitzenkandidatin, die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, kommen nicht auf wirklich durchschlagende und in Richtung eines eindeutigen Sieges zusteuernde Werte. Im Gegenteil, so gibt das Institut Infratest-Dimap am 2. Februar in seiner Vorwahlumfrage bekannt, dass ca. 32 % Giffey bei einer Direktwahl wählen würden, also nicht wirklich viele.
Zudem sind 67 % laut Infratest-Dimap mit dem SPD-geführten Senat eher unzufrieden. 2021, als die SPD in Berlin wie auch bei der Bundestagswahl - die beide am gleichen Tag stattfanden – gewann, waren es immerhin 59 %, die so dachten. Zurückzuführen war der eher mäßige Erfolg der Sozialdemokraten in Berlin also darauf, dass das Bundestagswahlergebnis die Berliner SPD mit „hochzog“ und der Berliner CDU eher schadete.
Derzeit scheint der „Oppositionseffekt“ der CDU zu nutzen und es ist damit zu rechnen, dass diese auch - seit der 1999er Abgeordnetenhauswahl - wieder stärkste Partei wird. Der Oppositionseffekt besagt, dass die Partei bzw. Parteien, die bei einer Bundestagswahl die Opposition bildet bzw. bilden, bei einer oder den Bundestagswahl(en) nachfolgenden Landtagswahl(en) eher mobilisieren kann bzw. können. Zumindest ist es in aller Regel so, die Landtagswahlen im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein bestätigten dieses Verhaltensmuster der Wahlberechtigten, im Saarland und Niedersachsen konnte die oppositionelle CDU allerdings nicht davon profitieren.
Die SPD ist also die einzige Partei bei dieser Wahl, bei der die Umfragedaten zwischen dem höchsten Stand bei der Forschungsgruppe Wahlen mit 21 % und dem FORSA-Institut mit dem niedrigsten Wert – 17 % - deutlich schwanken, während es bei der CDU zwischen 23 und 26 % sind. Die SPD scheint (!) sich zumindest etwas gefangen zu haben, ihre Umfragedaten sind – zumindest ohne den Ausreißer bei FORSA – um die 20 % angekommen zu sein.
Bündnis 90/Die Grünen hat sich von anfänglichen 21 % bei Infratest-Dimap jetzt auf 17 % in der Sonntagsfrage der Forschungsgruppe Wahlen eingependelt. Hierbei aber lässt sich vermuten, ob es auch bei diesen Prozenten am Wahlabend bleibt, denn die Grünen sind bei Umfragen hin und wieder überschätzt worden. Allerdings sind auch hier wieder „Ausnahmen von der Regel“ möglich. Der Trend aber scheint sich für die Grünen eher in Richtung “Leichter Rückgang” zu bewegen.
Die LINKE ist wohl ebenfalls zu den Wahlverlierern zu zählen, hatte die Partei bei der letzten Abgeordnetenhauswahl noch über 14 Prozent erzielt, dürften es jetzt um die 11 % sein.
Die FDP könnte wohl ca. einen %-Punkt verlieren. Die AfD liegt im Schnitt bei derzeit 10,2 %, sie dürfte also etwas hinzugewinnen, auch wenn sie von ihrem Ergebnis des Jahres 2016 noch recht weit entfernt ist. Aber auch hier kann man nicht genau sagen, wie hoch diese Partei am Ende abschneiden wird. 2021 wurde sie allgemein als zu hoch eingeschätzt, 2016 trafen die Umfrage-Daten weitestgehend zu.
Zumindest aber scheinen die Umfragewerte dem Berliner Drei-Parteien-Senat – SPD, Bündnis 90/Die Grünen und LINKE – ein „Weitermachen!“ zu bescheinigen, denn alle drei Parteien zusammen hätten den Umfragedaten zufolge eine Mandats-Mehrheit, zumal über 10 % auf die anderen Parteien entfallen.
Am Wahlabend aber werden wir besser informiert sein, Umfragen hin oder her.
Durchschnitt bei der „Sonntagsfrage“ im Januar: Leichter Rückgang bei Union und Grünen
Berlin, 31. Januar/1. Februar 2023: In der ersten Darstellung des Durchschnitts bei der „Sonntagsfrage“ („Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?“) erreichen die CDU und CSU zusammen in diesem Monat 27,9 %, nachdem beide im Dezember 2022 28,3 % erreichten. Beim Allensbacher Institut für Demoskopie erzielen beide Parteien sogar 31 % im Januar, bei Kantar und der Forschungsgruppe Wahlen liegen die Unionsparteien zur gleichen Zeit jeweils bei 27 %. Insgesamt aber sind die Unionsparteien nach wie vor die derzeit stärkste Gruppe bei den demoskopischen Erhebungen.
Die SPD folgt mit recht deutlichem Abstand, wieder auf dem zweiten Platz im Parteienranking und erreicht im Januar durchschnittliche 19,7 %. Sie hätte damit genau 6 %-Punkte gegenüber dem letzten Bundestagswahlergebnis vom September 2021 eingebüßt. Es ist davon auszugehen, dass diese Partei vom „Oppositionseffekt“ betroffen ist.
Ebenso wie die FDP, die immerhin 4,6 %-Punkte gegenüber dem letzten Bundestagswahlergebnis einbüßt und derzeit auf durchschnittliche 6,9 % kommt.
Bündnis ´90/Die Grünen erzielt im Januar genau 18 % (+ 3,2 %-Punkte). Die Grünen sind – als Partei in der Bundesregierung - vom Oppositionseffekt überraschenderweise nicht betroffen, obschon sie wieder deutlicher hinter der SPD liegen, nachdem sie im vergangenen Jahr gut 5 Monate demoskopisch vor dieser gelegen hatten.
Nachdem die AfD in den Umfragen recht lange über ihr Bundestagswahlergebnis von 10,3 % kaum hinausgekommen war, setzte sie ab Herbst 2022 dann doch zu Zugewinnen an. Inzwischen ist die AfD bei durchschnittlichen 14,3 % angelangt. Zu vermuten ist, dass diese sich aus dem Potential der FDP speisen und etwas weniger von Seiten der CDU/CSU.
Als kleinste der im Bundestag vertretenen Parteien erzielt die LINKE derzeit genau 5 %, sie würde geringfügig 0,1 %-Punkte zulegen. Im Jahr 2022 schwankte sie auch immer um die 5 %, im Mai kam sie mit dem niedrigsten Sonntagsfragen-Durchschnitt auf 4 %. Ob sich die LINKE dauerhaft oberhalb der 5 % einpendelt, bleibt abzuwarten.
Auch Erfolge oder Misserfolge bei den in diesem Jahr anstehenden Landtagswahlen tragen dazu bei, angefangen bei der Wiederholungswahl in Berlin, welche nun endgültig am 12 Februar stattfinden kann, nachdem das Bundesverfassungsgericht die Einsprüche dagegen zurückgewiesen hat.
Alle anderen Parteien, die „Sonstigen“, kommen bei dieser Durchschnittsberechnung auf 8,2 % (- 0,5 %-Punkte).
In Bundestagssitze umgerechnet, ohne Überhang- und Ausgleichsmandate, würde die SPD 128 Mandate erzielen, die CDU/CSU käme auf 182 Sitze, die Grünen auf 117, die FDP auf 45, die AfD würde 93 Sitze bekommen und die LINKE käme auf 33 Mandate.
Zur Erklärung: Es handelt sich bei dieser Rangliste nicht um eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, sondern dem Durchschnittswert, der sich aus der Berechnung der veröffentlichten Umfragedaten eines gesamten Monats der Institute Kantar, Infratest-Dimap, INSA-Consulere, der Forschungsgruppe Wahlen e. V., dem FORSA-Institut, GMS, und dem Institut für Demoskopie (Allensbach) sowie YouGOV ergibt
Situation bei der „Sonntagsfrage“ im Jahr 2022: Bericht und Kommentar
Berlin, 31. Dezember 2022/1. Januar 2023: Zum Jahresende 2022 stehen die Parteien, welche die „Ampel-Koalition“ - aus FDP, Bündnis 90/Die Grünen sowie die SPD (als größte Koalitionspartnerin sowie Kanzlerpartei) – bilden, zusammengenommen demoskopisch weitaus schlechter dar, als es am Ende 2021 ausgesehen hat. Aber diese drei Parteien sind demoskopisch unterschiedlich stark.
Die SPD liegt im Dezember bei durchschnittlichen 19,5 %, was einen Rückgang im Vergleich mit dem Bundestagswahlergebnis vom September 2021 ein Minus von 6,2 %-Punkten ergäbe. Dabei begann die SPD ihren Sinkflug erst nach den Landtagswahlen im Mai 2022 (Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein) und berappelte sich wieder etwas nach der Landtagswahl in Niedersachsen im vergangenen Oktober.
Die FDP hatte im Jahr 2022 dauerhafte demoskopische Rückgänge zu verzeichnen. Am Jahresende 2022 liegt sie nur noch bei 6,9 % und hätte damit rund 40 % ihrer Wählerschaft der Bundestagswahl eingebüßt. Die Frage ist bei den Liberalen, ob die AfD dieser Partei nicht auch in massiver Weise „das Wasser abgräbt“ oder die FDP aufgrund der demoskopischen Zunahme der CDU und CSU - demoskopisch - geschädigt wird.
Allerdings: die FDP stand bei Bundestagswahlen doch häufig besser da, als es ursprünglich - demoskopisch - ausgesehen hatte. 2021 begann die 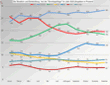 FDP mit 6,9 % bei den Umfragen, um dann bei der Bundestagswahl 11,5 % zu erreichen.
FDP mit 6,9 % bei den Umfragen, um dann bei der Bundestagswahl 11,5 % zu erreichen.
Bündnis 90/Die Grünen sind mit derzeit 18,4 % im Durchschnitt der Sonntagsfragen recht gut dastehend, diese Partei würde theoretisch zum Bundestagswahlergebnis von 2021 3,6 %-Punkte zulegen. Im Verlauf des Jahres 2022 hatten sie demoskopisch die SPD zumindest zeitweise (zwischen Juni bis Oktober) überholt, am Jahresende hat in dieser Konstellation wieder die SPD die Nase vorn. Ob die hohen Werte der Grünen aber so bleiben, wäre eine berechtigte Frage. In der Vergangenheit hatten die Grünen in Zeiten zwischen Bundestagswahlen immer wieder bessere Umfragedaten vorzuweisen, als es sich dann bei der jeweiligen Bundestagswahl ergeben hatte.
Bei den Oppositionsparteien im Bundestag liegt die CDU/CSU derzeit bei 28,3 % (+ 4,2 %-Punkte im Vergleich zum Bundestagswahlergebnis) weit vorn, ist aber noch lange nicht auf dem Niveau von deutlich vor der Bundestagswahl 2021 (erste zwei Monate des Jahres) und schon gar nicht auf dem hohen Niveau (zeitweise um die 40 %) während des Jahres 2020. Zudem ist auch die Frage berechtigt, ob die Unionsparteien nicht eher vom allgemeinen Oppositionseffekt profitieren.
Die AfD erzielte während des gesamten demoskopischen Jahres in den Umfragen zunächst um die 10 %, am Ende des Sommers 2022 kommt sie im Durchschnitt aller Sonntagsfragen nun deutlich höher als ihr Bundestagswahlergebnis (10,3 %) und im Dezember 2022 erreicht sie rund 14 %. Damit lässt sich feststellen, dass die AfD offenbar im bundesdeutschen Parteiensystem etabliert ist.
Verliererin in den Umfragen wie auch schon vorher bei der Bundestagswahl ist die LINKE, da diese zum Jahresende mit 4,8 % nicht die 5-%-Hürde überspringen würde. Allerdings ist hier keine endgültige Sicherheit gegeben, ob die LINKE nicht doch ein Ergebnis von mehr als 5 % erreichen könnte, zumindest lag sie zeitweise im Jahr 2022 viermal oberhalb von 5 %. Im Februar des Jahres kam diese Partei auf durchschnittliche 6,2 %.
Alle anderen Parteien begannen im Januar 2022 mit durchschnittlichen 7,3 %, bei der Bundestagswahl kamen alle diese auf 8,7 %, am Jahresende 2022 stehen diese als „Sonstige“ bezeichneten Parteien bei 8,1 %.
Zur Erklärung: Es handelt sich bei dieser Rangliste nicht um eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, sondern dem Durchschnittswert, der sich aus der Berechnung der veröffentlichten Umfragedaten eines gesamten Monats der Institute Kantar, Infratest-Dimap, INSA-Consulere, der Forschungsgruppe Wahlen e. V., dem FORSA-Institut, GMS, und dem Institut für Demoskopie (Allensbach) sowie YouGOV ergibt.