Situation bei der „Sonntagsfrage“ im Jahr 2022: Bericht und Kommentar
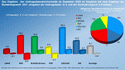
Die SPD liegt im Dezember bei durchschnittlichen 19,5 %, was einen Rückgang im Vergleich mit dem Bundestagswahlergebnis vom September 2021 ein Minus von 6,2 %-Punkten ergäbe. Dabei begann die SPD ihren Sinkflug erst nach den Landtagswahlen im Mai 2022 (Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein) und berappelte sich wieder etwas nach der Landtagswahl in Niedersachsen im Oktober 2022.
Die FDP hatte im Jahr 2022 dauerhafte demoskopische Rückgänge zu verzeichnen. Am Jahresende 2022 liegt sie nur noch bei 6,9 % und hätte damit rund 40 % ihrer Wählerschaft der Bundestagswahl eingebüßt. Die Frage ist bei den Liberalen, ob die AfD dieser Partei nicht auch in massiver Weise „das Wasser abgräbt“ oder die FDP aufgrund der demoskopischen Zunahme der CDU und CSU - demoskopisch - geschädigt wird.
Allerdings: die FDP stand bei Bundestagswahlen doch häufig besser da, als es ursprünglich - demoskopisch - ausgesehen hatte. 2021 begann die 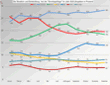 FDP mit 6,9 % bei den Umfragen, um dann bei der Bundestagswahl 11,5 % zu erreichen.
FDP mit 6,9 % bei den Umfragen, um dann bei der Bundestagswahl 11,5 % zu erreichen.
Bündnis 90/Die Grünen sind mit derzeit 18,4 % im Durchschnitt der Sonntagsfragen recht gut dastehend, diese Partei würde theoretisch zum Bundestagswahlergebnis von 2021 3,6 %-Punkte zulegen. Im Verlauf des Jahres 2022 hatten sie demoskopisch die SPD zumindest zeitweise (zwischen Juni bis Oktober) überholt, am Jahresende hat in dieser Konstellation wieder die SPD die Nase vorn. Ob die hohen Werte der Grünen aber so bleiben, wäre eine berechtigte Frage. In der Vergangenheit hatten die Grünen in Zeiten zwischen Bundestagswahlen immer wieder bessere Umfragedaten vorzuweisen, als es sich dann bei der jeweiligen Bundestagswahl ergeben hatte.
Bei den Oppositionsparteien im Bundestag liegt die CDU/CSU derzeit bei 28,3 % (+ 4,2 %-Punkte im Vergleich zum Bundestagswahlergebnis) weit vorn, ist aber noch lange nicht auf dem Niveau von deutlich vor der Bundestagswahl 2021 (erste zwei Monate des Jahres) und schon gar nicht auf dem hohen Niveau (zeitweise um die 40 %) während des Jahres 2020. Zudem ist auch die Frage berechtigt, ob die Unionsparteien nicht eher vom allgemeinen Oppositionseffekt profitieren.
Die AfD erzielte während des gesamten demoskopischen Jahres in den Umfragen zunächst um die 10 %, am Ende des Sommers 2022 kommt sie im Durchschnitt aller Sonntagsfragen nun deutlich höher als ihr Bundestagswahlergebnis (10,3 %) und im Dezember 2022 erreicht sie rund 14 %. Damit lässt sich feststellen, dass die AfD offenbar im bundesdeutschen Parteiensystem etabliert ist.
Verliererin in den Umfragen wie auch schon vorher bei der Bundestagswahl ist die LINKE, da diese zum Jahresende mit 4,8 % nicht die 5-%-Hürde überspringen würde. Allerdings ist hier keine endgültige Sicherheit gegeben, ob die LINKE nicht doch ein Ergebnis von mehr als 5 % erreichen könnte, zumindest lag sie zeitweise im Jahr 2022 viermal oberhalb von 5 %. Im Februar des Jahres kam diese Partei auf durchschnittliche 6,2 %.
Alle anderen Parteien begannen im Januar 2022 mit durchschnittlichen 7,3 %, bei der Bundestagswahl kamen alle diese auf 8,7 %, am Jahresende 2022 stehen diese als „Sonstige“ bezeichneten Parteien bei 8,1 %.
Zur Erklärung: Es handelt sich bei dieser Rangliste nicht um eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, sondern dem Durchschnittswert, der sich aus der Berechnung der veröffentlichten Umfragedaten eines gesamten Monats der Institute Kantar, Infratest-Dimap, INSA-Consulere, der Forschungsgruppe Wahlen e. V., dem FORSA-Institut, GMS, und dem Institut für Demoskopie (Allensbach) sowie YouGOV ergibt.